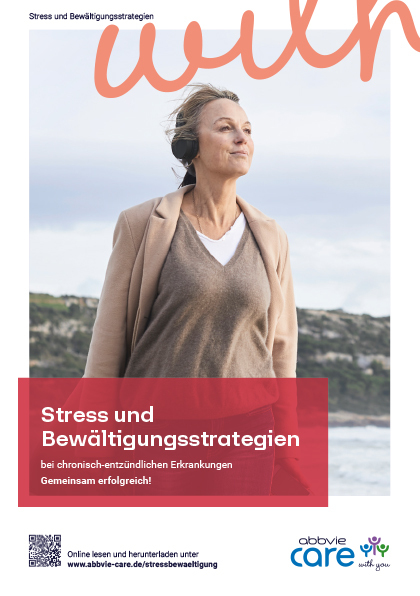Ernährung bei Morbus Crohn
Das Thema Ernährung hat bei Morbus Crohn einen besonderen Stellenwert, schließlich ist der Verdauungstrakt direkt betroffen. Eine spezielle Morbus-Crohn-Diät, die eingehalten werden muss, gibt es jedoch nicht.
Die wichtigste Ernährungsregel bei Morbus Crohn lautet: Erlaubt ist, was bekommt! Das bedeutet, dass Sie Ihre Ernährung auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, die Krankheitsaktivität oder auch mögliche Komplikationen ausrichten können. Basis sollte dabei eine ausgewogene und gesunde Ernährung sein. Auf diese Weise kann es Ihnen gelingen, positiv auf die Erkrankung und Ihr Wohlbefinden einzuwirken.
Individuelle Unverträglichkeiten bei Morbus Crohn
Ein wichtiger erster Schritt, um Ihren Speiseplan auf Ihre persönlichen Bedürfnisse auszurichten, ist es, herauszufinden, was Ihnen gut bekommt und was Sie nicht vertragen. Es gibt Lebensmittel, die eher gut oder eher nicht gut bekömmlich sind. Verallgemeinern lässt sich das jedoch nicht. Unverträglichkeiten können sich darüber hinaus mit der Zeit ändern, etwa im Schub oder wenn die Krankheitsaktivität nachlässt.
Ernährungstagebuch
Ein Ernährungstagebuch kann Ihnen dabei helfen, Unverträglichkeiten aufzuspüren. Eine Vorlage mit Anleitung finden Sie weiter unten zum Download. Denken Sie daran, dass es von Zeit zu Zeit sinnvoll sein kann, erneut ein Ernährungstagebuch zu führen, falls Unverträglichkeiten sich geändert haben.
Ernährung während eines Schubs
Während eines Schubs kann der Körper bei Morbus Crohn mit Ihrer gewohnten Ernährung überfordert sein. Oft werden dann weniger Speisen vertragen. Der Verzicht auf Ballaststoffe kann helfen, die entzündete Darmschleimhaut zu schonen. Leicht verdauliche und pürierte Speisen sind besonders gut verträglich. Achten Sie darauf, ausreichend Flüssigkeit, Nährstoffe und Kalorien aufzunehmen, wenn die Erkrankung aktiv ist.
Nährstoffmangel vorbeugen
Wenn der Körper mit einer Entzündung klarkommen muss, hat er einen erhöhten Nährstoff- und Flüssigkeitsbedarf. Auf der anderen Seite kann die Entzündung des Darms die Nährstoffaufnahme mindern, Durchfall zu Flüssigkeitsverlust führen und Appetitlosigkeit das Essen erschweren. Es ist daher wichtig, einer Unterversorgung mit einzelnen Vitaminen, Mineralstoffen oder Spurenelementen sowie einem Gewichtsverlust entgegenzuwirken. Der Mangel eines bestimmten Nährstoffs sollte stets vom behandelnden Arzt festgestellt werden. Ein Blutbild kann aufdecken, ob es zu einem Mangel gekommen ist. Gelingt es nicht, genug zu essen, um die nötigen Kalorien aufzunehmen, kann Trinknahrung eine Unterstützung sein, um einen Gewichtsverlust zu vermeiden. Auch in diesem Fall sollten Sie sich mit Ihrem behandelnden Arzt abstimmen.
10 Punkte für eine ausgewogene Ernährung
Bei Morbus Crohn wird eine gesunde und ausgewogene Ernährung unter Berücksichtigung der individuellen Unverträglichkeiten und Bedürfnisse empfohlen. Doch was bedeutet gesunde Ernährung? Die 10 Punkte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) geben eine gute Orientierung für einen ausgewogenen Speiseplan:
- Vielseitig essen
- Gemüse und Obst – „5 am Tag“, das heißt fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag, möglichst frisch, nur kurz gegart
- Bei Getreideprodukten besser Vollkorn als Weißmehl wählen
- Tierische Lebensmittel als Ergänzung: täglich Milch und Milchprodukte; ein- bis zweimal in der Woche Fisch; nicht mehr als 300 bis 600 g Fleisch pro Woche
- Bewusste Auswahl von Fetten: pflanzlichen Ölen den Vorzug geben; versteckte Fette in verarbeiteten Lebensmitteln meiden
- Zucker und Salz in Maßen
- Reichlich Flüssigkeit: ca. 1,5 Liter am Tag trinken, bevorzugt Wasser
- Speisen schmackhaft und schonend zubereiten
- Achtsam essen: Zeit nehmen und das Essen genießen
- Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben
Entzündungsbewusster Speiseplan
Neben einer ausgewogenen Ernährung kann sich eine bewusste Auswahl von Lebensmitteln positiv auf das Entzündungsgeschehen im Körper auswirken. Dabei sind es vor allem Fette, Vitamine und Spurenelemente, die eine besondere Rolle spielen.